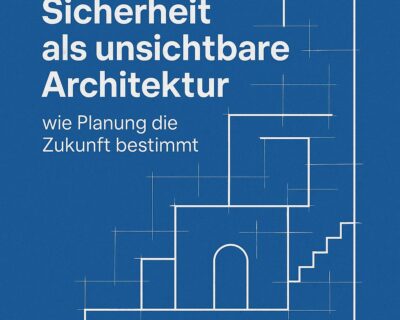ÖNORM B 1300 und B 1301 – Eine neue Ära der Objektsicherheit.
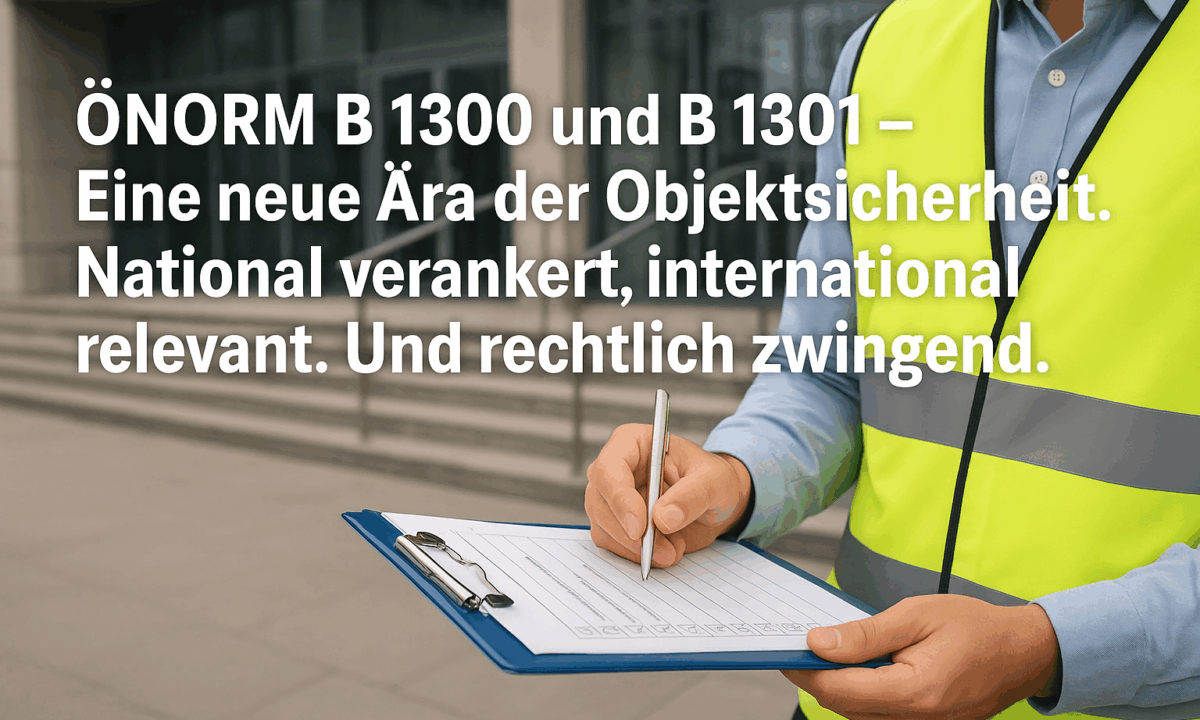
National verankert, international relevant. Und rechtlich zwingend.
Die Sicherstellung der Objektsicherheit ist nicht nur eine Frage von Professionalität oder technischem Qualitätsbewusstsein. Sie ist auch eine gesetzliche Verpflichtung, die unmittelbar aus dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) entsteht. Eigentümer und Betreiber eines Gebäudes sind verpflichtet, Gefahren, die von ihrem Objekt ausgehen könnten, zu erkennen und zu verhindern.
Diese sogenannte Verkehrssicherungspflicht bedeutet, dass jede Person, die ein Gebäude besitzt oder betreibt, dafür sorgen muss, dass von diesem Gebäude keine Gefahr für Personen oder Sachen ausgeht. Wer dieser Pflicht nicht nachkommt, riskiert erhebliche Haftungsfolgen.
Die ÖNORM B 1300 und die neu erschienene ÖNORM B 1301:2025-11 bieten hierfür ein praxistaugliches, strukturiertes und rechtlich hochrelevantes Instrument, um genau diese Pflicht professionell zu erfüllen. Sie schaffen Nachvollziehbarkeit, Belegbarkeit – und im Ernstfall auch Rechtssicherheit.
Warum regelmäßige Objektsicherheitsprüfungen rechtlich notwendig sind
Die Verkehrssicherungspflicht ist in Österreich nicht optional, sondern gesetzlich verankert.
Sie ergibt sich insbesondere aus den Bestimmungen des ABGB, darunter:
§ 1295 ABGB (allgemeine Schadenersatzpflicht)
§ 1297 ABGB (Sorgfaltsmaßstab)
§ 1311 ABGB (Haftung bei Unterlassung zumutbarer Sicherungsmaßnahmen)
§ 1319 ABGB (Haftung des Gebäudeeigentümers für mangelhafte Bauten)
Diese Bestimmungen verpflichten Eigentümer und Betreiber, alle zumutbaren und erforderlichen Maßnahmen zu setzen, um Gefahren zu vermeiden – unabhängig davon, ob die Gefahr vorhersehbar war oder nicht.
Und genau hier setzen ÖNORM B 1300 und B 1301 an:
Sie definieren, was als zumutbar gilt, wie die Prüfung vorzunehmen ist, und welche Nachweise zu führen sind.
Haftungsrisiken bei fehlenden oder fehlerhaften Prüfungen
1. Zivilrechtliche Haftung
Wenn eine Person durch einen vermeidbaren Mangel verletzt wird – z. B. durch:
herabfallende Fassadenteile,
defekte Handläufe,
mangelhafte Fluchtwegbereiche,
unzureichend gewartete technische Anlagen,
rutschige Bodenbeläge, lose Stufen oder unbeleuchtete Bereiche –
dann haftet der Eigentümer bzw. Betreiber, wenn er keine angemessenen Prüfungen durchgeführt hat.
2. Strafrechtliche Verantwortung
Kommt es zu Personenschäden, können strafrechtliche Konsequenzen entstehen, etwa:
fahrlässige Körperverletzung
fahrlässige Gemeingefährdung
fahrlässige Tötung
Diese Tatbestände greifen insbesondere dann, wenn organisatorische oder technische Prüfpflichten verletzt wurden.
3. Versicherungsrechtliche Ablehnung
Versicherungen prüfen im Schadensfall regelmäßig:
Wurden die vorgeschriebenen Prüfungen durchgeführt?
Wurde die Dokumentation geführt?
War der Betreiber seiner Verkehrssicherungspflicht nachweislich nachgekommen?
Fehlen Prüfberichte oder sind „sichtbare Mängel“ dokumentiert, aber nicht behoben, kommt es häufig zu:
Leistungskürzungen
vollständigen Leistungsablehnungen
Regressforderungen gegen den Betreiber
4. Organisatorische Haftung
Auch Verwalter, Geschäftsleiter, Facility-Manager oder betriebliche Sicherheitsbeauftragte können zur Verantwortung gezogen werden, wenn delegierte Prüfpflichten nicht ordnungsgemäß durchgeführt oder dokumentiert wurden.
Die ÖNORM B 1301:2025-11 als rechtliche Absicherung
Die neue ÖNORM B 1301:2025-11 formuliert präziser als jede Version davor, wie die Verkehrssicherungspflicht praktisch umzusetzen ist.
Dazu zählen:
klare Prüfschritte und Prüfzyklen,
definierte Checklisten,
nachvollziehbare Dokumentation,
eindeutige Abgrenzung der Verantwortungsbereiche,
strukturierte Mängelbehebung,
Pflicht zu Folgebegehungen,
und die lückenlose Archivierung aller Unterlagen.
Diese Struktur ermöglicht Betreibern, im Schadensfall beweisen zu können, dass sie ihrer Pflicht nachgekommen sind – ein entscheidender Punkt im Rahmen der Haftungsfrage.
Internationale Standards unterstützen dieselbe Logik
Auch internationale Regelwerke (NFPA, IEBC, ComSOP, VDI, DIN, ISO) beruhen auf derselben rechtlichen Grundidee:
👉 Wer ein Gebäude betreibt, trägt Verantwortung.
Wer Verantwortung trägt, muss prüfen, dokumentieren und handeln.
Damit zeigt sich: Die ÖNORM B 1301 ist nicht nur eine technische Norm – sie ist ein international anschlussfähiges Rechts- und Organisationsinstrument.
Ein erweitertes Zeichen professioneller Verantwortung
Die neue B 1301 hebt die Objektsicherheit in Österreich auf ein Niveau, das:
technisch präzise,
organisatorisch klar strukturiert,
international vergleichbar
und rechtlich abgesichert
ist.
Damit profitieren Betreiber, Eigentümer, Unternehmen und Nutzer gleichermaßen:
Sicherheit wird planbar. Risiken werden beherrschbar. Haftung wird minimiert.
Und vor allem:
Die Einhaltung der ÖNORM B 1300 und B 1301 ist der belastbare Nachweis dafür, dass man seine Verantwortung gegenüber Menschen und Eigentum ernst nimmt.